Acht Forschende, acht Vorträge – und jeweils nur vier Minuten, um ihr Forschungsprojekt zu präsentieren. Sie sind Expertinnen und Experten auf ihren jeweiligen Gebieten, und Forschung zu betreiben ist ihre Hauptaufgabe. Forschung zu vermitteln, und zwar Fachfremden, ist jedoch ein Schritt aus der Komfortzone heraus.
In nur 240 Sekunden – die gerade mal reichen, um eine fertige Spülmaschine auszuräumen – haben sie sich am 11. Tag der Forschung der Herausforderung und der vierköpfigen Fachjury gestellt: Andreas Hanninger, Frank Edenharter, Jonas Weber, Laura Lemberger, Mahboubeh Tajmirriahi, Nils Rabeneck, Santhosh Kumar Nataraj und Zubeir El Ahmad.
Bewaffnet mit Mikrofon und PowerPoint-Präsentation galt es für die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der THD-Lehr- und Technologie Campi, ihre komplexen Projekte anschaulich zu kommunizieren. Auf sie wartete der Best Presentation Award für den besten Vortrag und die Best Poster Awards für die drei besten wissenschaftlichen Poster.
TSR – Die Krebszelle und das Hühnerei
Wahrscheinlich geriet die Aufmerksamkeit des Publikums beim Titel ihrer Präsentation etwas auf Abwege, aber Laura Lemberger schaffte schnell Klarheit zum Thema „Die prognostische Rolle des TSR in PDAC ‒ Evaluierung der Beziehung zwischen dem Tumor-Stroma-Verhältnis und dem Ki-67- und p53-Status im duktalen Adenokarzinom“. Das duktale Adenokarzinom des Pankreas (PDAC) ist eine Krebserkrankung der Zellen des Gangsystems der Bauchspeicheldrüse. Lemberger untersucht das Massenverhältnis der Tumorgesamtgröße und des reinen Tumorstromas (TSR), dem – sehr vereinfacht ausgedrückt – „Bindegewebe des Krebsorgans“. Dabei analysiert sie einerseits, ob sich der Krankheitsverlauf anhand dieses Verhältnisses aussagekräftig prognostizieren lässt, und andererseits, ob die Größe der Stromamasse den Schweregrad der Krankheit verschlimmern könnte.
Als Testobjekt dient ein befruchtetes, bebrütetes Hühnerei, in dem Tumorgewebe kultiviert wird. Das geschieht auf der Chorion-Allantois-Membran (CAM), die der menschlichen Plazenta ähnelt und losgelöst von der Eischale den Embryo umschließt. Zusätzlich zur prognostischen Aussagekraft untersucht Lemberger die Wirksamkeit zielgerichteter Chemotherapeutika. Diese passen sich dem Tumor genetisch an und werden nur in den entarteten Zellen und nicht in anderen Körperzellen aktiv.
[Projekt: Evaluierung der Beziehung zwischen dem Tumor-Stroma-Verhältnis und dem Ki-67- und p53-Status im duktalen Adenokarzinom]

Das Digitale Alpendorf – Der Balanceakt zwischen analog und digital
Wer kennt nicht den urbayerischen Spruch, dass „man das immer schon so gemacht hat“ und dass „es das ja noch nie gegeben hat“? Beim Digitalen Alpendorf handelt es sich um ein Digitalisierungsprojekt, das festgefahrene Strukturen überdenken und neue Impulse für die Heimatregion schaffen soll. Oberstes Gebot ist dabei die Wahrung der „Digital-Analog-Balance“, wie Frank Edenharter, Projektmitarbeiter am TC Grafenau, in seiner Projektpräsentation betonte.
Digitale Chancen für die Weiterentwicklung kleiner ländlicher Kommunen und interkommunaler Zusammenschlüsse – aber ohne die eigene Identität aufzugeben. Das bedeutet aktive Partizipation und nachhaltige Strukturen. Rathausgänge online zu ermöglichen, Medienschulungen für Ältere, Online-Mitwirkplattformen für Jugendliche oder Apps für Touristen, die das individuelle Freizeit- und Kulturangebot visuell ansprechend vermitteln ‒ all das gehört dazu. Als bereits realisiertes Beispiel aus der Wirtschaft nannte Edenharter einen Verein lokaler Bio-Landwirtinnen und -landwirte sowie nachfolgender Produzenten. Gemeinsam betreiben sie eine Online-Plattform, um ihre eigenen Erzeugnisse ohne Mittelhandel selbst zu vermarkten.
Das Digitale Alpendorf ist als Reallabor konzipiert. Das bedeutet, dass während der Umsetzung des Projekts alle Akteure, wie Kommunalverwaltungen, Tourismusorganisationen oder wirtschaftliche Zusammenschlüsse, ihr Feedback durchgängig einbringen und somit die Strukturen partizipativ anpassen können.
[Projekttitel: Digitales Alpendorf – digitale Transformation und Nachhaltigkeit Hand in Hand für eine erfolgreiche interkommunale Zukunft im ländlichen Alpenraum]
C-AFM – Eine filigrane Testspitze und eine buchstabenreiche Methode
In der Doktorarbeit von Jonas Weber wird es filigran. Am Institut für Qualitäts- und Materialanalysen (IQMA) erforschte er, wie die Zuverlässigkeit der elektrischen Rastersondenmikroskopie verbessert werden kann. Im Englischen bekannt als Conductive Atomic Force Microscopy oder kurz C-AFM, wird sie zur Oberflächencharakterisierung elektronischer Komponenten eingesetzt. Das Besondere daran: Es wird gleichzeitig die Oberfläche im Nanometerbereich topografisch vermessen als auch die zugehörige ortsaufgelöste elektrische Leitfähigkeit des Materials aufgenommen.
Ähnlich einer Schallplattennadel fährt eine Messspitze rasterförmig über das Testmaterial. Schon durch ihren kleinen Radius ist sie anfällig für mechanischen Abrieb. Das größere Problem ist jedoch die hohe Stromdichte, die zwischen Material und Messkontakt auftritt. Das führt dazu, dass die leitende Beschichtung der Spitze schmilzt und die Messergebnisse verfälscht werden.
Nach intensiven Analysen und Tests an der momentanen Technik erarbeitete Weber verschiedene Lösungsansätze, beispielsweise mit Messkontakten aus Vollmaterial, sowie unterschiedlichen Beschichtungen, aber auch mit softwarebasierten Methoden. Das Resultat seiner Forschung war eine individuell anpassbare Probenhalterung mit integriertem CMOS-Transistor. Dieser reduziert die entstehende Stromdichte und verlängert die Lebensdauer der Messpitzen, wodurch zuverlässigere Messungen ermöglicht werden.
[Projekttitel: Improving the Reliability of Conductive Atomic Force Microscopy (C-AFM)]
GreenGlass 4.0 – Nachhaltiges Silikatglas
Ist Glas nicht von Natur aus nachhaltig? Man sagt doch, es kann unendlich oft und rückstandslos recycelt werden? So einfach ist es leider nicht. Die Herstellung von Glas, insbesondere der Schmelzvorgang, ist äußerst energieintensiv, dabei werden Schmelzwannen größtenteils sogar noch mit Gas befeuert. Das stellt die heimische Glasindustrie vor ein Problem, denn sie verbraucht große Mengen fossiler Rohstoffe und erzeugt jährlich ganze 4 Millionen Tonnen Treibhausgase.
Deswegen wird am TAZ Spiegelau eine vollelektrisch betriebene Schmelzwanne entwickelt, wie Andreas Hanninger in seiner Präsentation erläuterte. Deren Schmelzleistung soll individuell anpassbar sein, und sie soll sich für verschiedene Glasarten wie klare, grüne und braune Gläser zugleich eignen. Schon dadurch wird sich die E-Schmelzwanne grundlegend von den üblichen Industrieanlagen, die meist nur für eine bestimmte Glasart genutzt werden können, unterscheiden. Zusätzlich wird auf die Vollautomatisierung der Anlagen durch ein KI-basiertes Regelungssystem gesetzt.
[Projekttitel: GreenGlass 4.0: Entwicklung von Produktionsverfahren zur Erzeugung nachhaltiger Gläser]
AutoClean – Die Intelligenz eines Roboters
Die additive Fertigung – den meisten bekannt als 3D-Druck – ist bekannt als schnelle und relativ kostengünstige Methode, um Einzelstücke oder Kleinserien herzustellen. Im pulverbasierten Kunststoff-3D-Druck gibt es jedoch Verbesserungspotenzial in der Nachbearbeitung, beispielsweise bei der Entfernung von Pulverrückständen, Sortierarbeiten oder optischen Qualitätskontrollen. Diese werden nämlich überwiegend noch manuell ausgeführt und sind kosten- und zeitaufwändig.
Nils Rabeneck, wissenschaftlicher Mitarbeiter, stellte am Tag der Forschung ein Projekt des TC Hutthurm vor, in dem ein universelles, automatisiertes Nachbearbeitungssystem für den pulverbettbasierten 3D-Druck entwickelt wurde. Es umfasst ein KI-basiertes und vollautomatisches Sortier- und Reinigungsverfahren sowie eine integrierte Qualitätskontrolle. Dafür kooperierte das Team sowohl mit dem TC Cham als auch mit regionalen Unternehmen.
Zunächst analysierte man die Produktionskette, unterstützt durch Simulationen. Dabei wurden Fertigungsschritte wie der Materialtransport oder auch die Funktionstauglichkeit der Anlage getestet und auf ihr Optimierungspotenzial überprüft. Basierend darauf entwickelte man eine Rüttelplatte zur Entfernung grober Pulverrückstände und ein anschließendes Reinigungsverfahren per Strahlvorgang, um Bauteile restlos zu säubern.
Ein Greifroboter, ausgestattet mit einem Erkennungsalgorithmus, erfasst die Bauteilgeometrie der Produkte und ergreift diese dadurch sicher und individuell. Zusätzlich wurde eine KI mit synthetisch erstellten Bildern trainiert, um Bauteile zu erkennen und sie ihrem Druckauftrag zuzuordnen. Auch die vollautomatische optische Qualitätskontrolle erfolgt mittels Bilderkennung.
[Projekttitel: Automatische Nachbearbeitungsstation mit integrierter Qualitätskontrolle und Sortierstation für Bauteile aus pulverbett-basierten 3D Druckern - AutoClean]
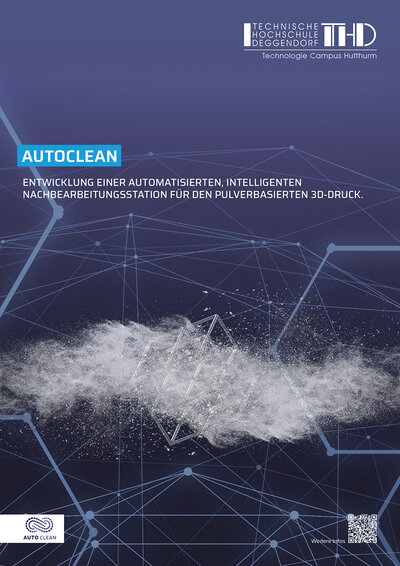
CAIDAN – Tatort Netzwerk
Wenn ein Hacker erfolgreich ins Netzwerk eines Unternehmens eindringt, stehen ihr oder ihm eine Vielzahl an Möglichkeiten weiterer Schritte zur Verfügung – beispielsweise das Auslesen von Kundendaten oder produktbezogener Dokumente. Cybersecurity entwickelt sich zwar stetig weiter, aber so tun es auch die Methoden der Eindringlinge. Das Problem: Klassische Angriffserkennungssysteme registrieren oft nur bereits bekannte Angriffsmethoden oder lösen durch mangelnde Kontextualisierung Fehlalarme aus. Zudem ist es für IT-Forensiker im Falle der Vorfallsaufklärung schwierig, Angriffe effektiv bis zur Quelle zurückzuverfolgen.
Das Projekt CAIDAN will das ändern und ein KI-gestütztes Signatur- und Angriffserkennungssystem entwickeln, das die Zuordnung von Cyberangriffen in Echtzeit leistet. Dazu soll eine Künstliche Intelligenz unter anderem in den Datenströmen nach Anomalien suchen, um Angriffe frühzeitig zu erkennen und geeignete Maßnahmen zu ergreifen. Santhosh Kumar Nataraj, wissenschaftlicher Mitarbeiter am TC Vilshofen, stellte das Kooperationsprojekt der Technischen Hochschule Deggendorf und der Universität Augsburg am Tag der Forschung vor.
Das Forscherteam strebt ein skalierbares, nachvollziehbares System für industrielle Netzwerke an, das eine sichere Infrastruktur gewährleistet und forensische Arbeit im Nachgang erleichtert. Besonders in kleinen und mittelständischen Unternehmen ergibt sich bei fortschreitender Digitalisierung und Vernetzung der Bedarf an leichtgewichtigen Lösungen. Sie benötigen ein effizientes und gleichsam erschwingliches System und das will CAIDAN leisten.
[Projekttitel: Cyberattack Attribution Using AI-Enhanced Intrusion Detection with alert Correlation in Industrial Networks]
ELISA – Traue niemandem, auch nicht dir selbst
Denkt man an die Sicherheit von E-Autos, ist Cybersecurity nicht das Erste, das einem in den Sinn kommt. So wie für die Betriebsart dieser Fahrzeuggeneration gelten aber auch für die technologischen Weiterentwicklungen andere Bedingungen und Herausforderungen. Dem stellt sich am TC Vilshofen das Projekt ELISA – Elektromobilität durch Interoperable und Sichere Architekturen. Mahboubeh Tajmirriahi, wissenschaftliche Mitarbeiterin, erläuterte das Vorhaben.
Im Fokus stehen die Anwendungsfälle Plug&Charge und Car Access. Plug&Charge ist eine Lademethode für E-Autos, die an der Ladesäule keine App oder Chipkarte, sondern das Auto selbst als Authentifizierungsfaktor nutzt und ohne eigenes Zutun den Zahlvorgang abwickelt. Car Access beschäftigt sich mit der Entwicklung digitaler Fahrzeugschlüssel, die beispielsweiße mit einem Smartphone genutzt werden können und zusätzliche Funktionen wie berechtigungseingeschränktes Carsharing ermöglicht. Für beide Anwendungsfälle spielt die Sicherheit der Fahrzeugarchitektur und des Fahrzeugnetzwerks – das die Verbindung des Autos zum Internet und damit weiteren digitalen Anwendungen und Geräten beherbergt – eine entscheidende Rolle.
Das Projektteam will die Erstellung, sichere Übermittlung sowie Speicherung kryptographischer Assets (z.B. Schlüssel und Zertifikate einer Public-Key-Infrastruktur (PKI)) in diesen Prozessen optimieren. Grundlage ist eine Zero-Trust-Architektur – ein IT-Sicherheitskonzept, das grundsätzlich davon ausgeht, dass kein Gerät, Nutzer oder Netzwerk vertrauenswürdig ist. Zudem soll ein Hardware-Sicherheitsanker in das Fahrzeug integriert werden, der sicherheitsrelevante Daten und Prozesse in einem dedizierten, manipulationssicheren Modul schützt.
Für die Sicherheit digital vernetzter Autos gibt es bereits ISO-Normen und Spezifikationen. Ziel des Projekts ist es diese Normen zu prüfen und in die nächste Generation zu bringen, indem eine allgemeingültige, widerstandsfähige Sicherheitsarchitektur entwickelt wird.
[Projekttitel: Elektromobilität durch Interoperable und Sichere Architekturen]

BioInf – Das maligne Melanom: Wenn Proteine zu Tumortreibern werden
Es gibt nicht die eine Zellmutation, die zu Krebs führt. Tumorzellen folgen ihren ganz eigenen Spielregeln. Und davon haben sie viele. Einige begünstigende Faktoren konnten bereits wissenschaftlich analysiert werden. Aber noch nicht alle molekularen Mechanismen, die zur unkontrollierten Zellvermehrung in Tumoren führen, sind ganzheitlich aufgeklärt.
Der Bioinformatiker und wissenschaftliche Mitarbeiter Zubeir El Ahmad der Forschungsgruppe BIOinformatik widmet sich in seiner Doktorarbeit dem Wachstumsprozess des malignen Melanoms (schwarzer Hautkrebs). Um genau zu sein, untersucht er Proteine aus der AP-1-Transkriptionsfaktorfamilie (AP ist kurz für Activator Protein). Diese sogenannten Transkriptionsfaktoren wirken beinahe wie Schalter, die Gene aktivieren oder deaktivieren, und eine tragende Rolle im Zellwachstum und der Zellregulierung einnehmen. Das Projekt erforschte unter anderem, in welchen Regionen unseres Erbguts eine Bindung stattfindet und welche Mitglieder der Familie involviert sind. Zudem wurden potenzielle Co-Transkriptionsfaktoren gesucht, die mit AP-1-Proteinen interagieren und so zusätzlich zum Tumorwachstum beitragen könnten.
El Ahmad konnte in Zellen maligner Melanome feststellen, dass sich viele Bindungsstellen dieser Proteine in transkriptionell aktiven Regionen der DNA befinden. Außerdem bemerkte er nahe der AP-1-Bindungsstellen häufig ein DNA-Motiv, also eine bestimmte Gensequenz, an das Proteine einer weiteren Transkriptionsfaktorfamilie binden. Das könnte für die Funktion als Co-Transkriptionsfaktor sprechen. Darüber hinaus stellte er ein gemeinsames Auftreten beider Bindungsmotive in etwa 100 Genen fest, die im malignen Melanom signifikant dereguliert waren. Die Aktivität einiger Gene schien dabei vom Entwicklungsstadium des Tumors abzuhängen.
[Projekttitel: Molekulare Mechanismen der unterschiedlichen Transkriptionsaktivität der AP-1-Faktoren c-Jun, Fra-1 und ATF-2 und ihre funktionelle Bedeutung beim malignen Melanom]
Das Gewinnertreppchen, der Pokal, die Medaillen
Wer hat gewonnen? Den Best Presentation Award sicherte sich Laura Lemberger mit ihrem Forschungsprojekt zur Stromamasse von Bauspeicheldrüsentumoren. Stellvertretend nahm sie den Wanderpokal für das gesamte Team unter der Leitung von Prof. Dr. Thiha Aung (THD), Prof. Dr. Silke Haerteis (Universität Regensburg) und Prof. Dr. Christina Hackl (Uniklinikum Regensburg) entgegen.
Best Presentation Award: Gewinnerin Laura Lemberger und Vize-Präsident Andreas Grzemba (v.r.).
Die Vorgabe für die wissenschaftlichen Poster lautete „Ein Bild, ein Satz – Forschung auf einen Blick“. Als Top Three von 24 setzten sich durch: Nils Rabeneck mit AutoClean, Mahboubeh Tajmirriahi mit ELISA und Lukas Schmidbauer mit dem Thema Wahrnehmung von Pflegekräften zu KI.
Friends, researchers, colleagues, lend me your ears! Der 12. Tag der Forschung steht bereits in den Startlöchern und jedes Projekt ist willkommen! Termin ist der 25. Februar 2025. Alle weiteren Infos – auch zur Anmeldung – in Kürze unter Tag der Forschung.